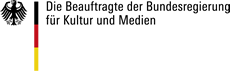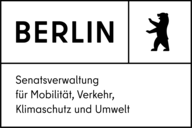„Ja, es ist schon viel Demut entstanden.“
Ein Gespräch über Sterben und Tod in Zeiten einer Pandemie
Das Gespräch mit Prof. Dr. Ralf Michael Muellenbach und Heike van Elkan führte Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Zentralinstituts und Museums für Sepulkralkultur, am 30. Juni 2021 im Klinikum Kassel.
Prof. Dr. med. Ralf Michael Muellenbach ist seit 2016 Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Klinikums Kassel, und Heike van Elkan ist als „Pflegerische Leitung Intensivstation“ beim Klinikum Kassel angestellt. Bei einem Rundgang über die Intensivstation wird schnell deutlich, dass es hier täglich um den Scheideweg zwischen Leben und Tod geht. Es ist erstaunlich leise, und als ich diesen Eindruck formuliere, erwidern beide umgehend, dass sie es heute eher als laut empfinden. Anlass des Besuchs ist ein Interview zum Thema „Sterben auf der Intensivstation“. Die mediale Berichterstattung im Rahmen der Covid-19-Pandemie drehte sich immer wieder um die besonders schwierige Arbeit der Intensivmedizin und um das Thema „Einsames Sterben“. Über die zahlreichen medialen Berichte und Artikel entstand in den letzten Monaten der Eindruck, dass teils chaotische Verhältnisse vorherrschen würden, dass die technischen Geräte laut und nervenaufreibend im Dauerbetrieb piepsen und dass die Menschlichkeit in der Pflege und der Sterbebegleitung seit Beginn der Pandemie gelitten habe. So viel sei vorab schon verraten: Keine dieser negativen Erwartungen, die ausschließlich durch mediale Sekundärerfahrungen geprägt waren, wurde bestätigt.
Das Interview erscheint auch in der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift für Sepulkralkultur!

© Gesundheit Nordhessen, Foto: Tyler Larkin
Gespräch
Dirk Pörschmann (dp): Was bedeutet Sterben auf einer Intensivstation, und wie können die Angehörigen und Seelsorger*innen eingebunden werden?
Heike van Elkan (HvE): Auf einer Intensivstation ist Sterben immer eine gemeinsame Therapieentscheidung von Ärzt*innen, von Pflegekräften und von Angehörigen. Wir führen vorab viele Gespräche mit den Angehörigen und mit unserem Team. Die Patienten sind ja meist nicht mehr bei Bewusstsein. Spätestens wenn sich abzeichnet, dass der Patient sterben wird und sterben darf, werden die Angehörigen aktiv einbezogen. Wir versorgen die Sterbenden palliativ, so dass sie keine Schmerzen und keine Luftnot haben. Die Angehörigen können auch beim Sterben dabei sein und die Sterbenden berühren. Das Zimmer wird so gestaltet, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Wir versuchen, die Geräte so weit wie möglich in den Hintergrund zu schieben und lassen die Angehörigen am Bett sitzen. Zudem minimieren wir die Alarme und das Piepen, so dass diese nicht stören, wobei die Angehörigen das ja in der Regel auch schon alles kennen. Wir erklären den Angehörigen auch, was beim Sterben eines Menschen geschieht, damit sie sich darauf vorbereiten können. Wenn sie sich die Begleitung eines Geistlichen oder eines Seelsorgers wünschen, werden diese selbstverständlich auch mit einbezogen. Und dann wird vorher im Gespräch auch geklärt, ob die Angehörigen allein mit der Seelsorge sein möchten. Dann halten wir uns eher im Hintergrund.
Prof. Dr. med. Ralf Michael Mühlenbach (RM): Die Patientinnen und Patienten, die auf unseren Stationen liegen, haben ja ganz unterschiedliche Krankengeschichten. Manche kommen z. B. durch Unfälle, nach großen Operationen oder Suizidversuchen akut auf die Intensivstation, andere befinden sich in der letzten Phase einer chronischen Erkrankung. Sterben in der Intensivmedizin ist meist ein Zurücknehmen von lebenserhaltenden oder sterbeprolongierenden Maßnahmen. Nehmen wir das Beispiel eines Patienten nach Herzinfarkt mit Reanimation und irreversiblem Ausfall der Hirnfunktion: Hier sprechen wir von einer infausten Prognose, und dann müssen wir erst einmal mit der Familie klären, ob eine Patientenverfügung vorliegt oder ob sich der Patient zur Organspende bereit erklärt hat. Auf einer Intensivstation verstirbt in der Regel niemand akut, denn wir können häufig technisch intervenieren. Wenn wir bewusst nichts mehr unternehmen, dann haben wir das schon vorher geklärt und entschieden. Das sind z. B. chronisch erkrankte Patienten mit einer langen Krankengeschichte und einer sehr ungünstigen Prognose, die wir dann nicht mehr reanimieren oder intubieren. Dann arbeiten wir palliativ. Im Normalfall würden wir einen Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand reanimieren und ihn ggf. auch an Maschinen nehmen, die das Herz ersetzen. Wir entscheiden immer gemeinschaftlich im Team, also mit Pfleger*innen und Ärzt*innen und natürlich den Angehörigen, wenn wir von einem kurativen in das palliative Ziel wechseln. Manchmal sprechen wir auch mit den Seelsorger*innen, und für Grenzfälle haben wir eine Ethikkommission im Klinikum, die uns unterstützt.
dp: Kann die Intensivmedizin in jeder Situation Leben erhalten oder einen Sterbeprozess aufhalten?
RM: Ja, das kann man in den allermeisten Fällen. Wenn aber ein reanimierter Patient Richtung Hirntod geht, dann sind manchmal die Organsysteme durch die Dysfunktion des Gehirns so stark beeinträchtigt, dass dann auch mit unseren Maßnahmen Leben nicht mehr erhalten werden kann. Wir beobachten das sehr genau. Das Schwierige an der Intensivmedizin ist, immer zu erkennen, wann der Sterbeprozess beginnt. Der medizinische und technische Fortschritt kann das Leben verlängern, aber auch das Sterben hinauszögern. Das ist auch für uns nicht immer unmittelbar sichtbar. Dennoch müssen wir uns bei allen Entscheidungen 100 Prozent sicher sein – kein einfacher Spagat.
dp: Sie sagen: „Leben verlängern“ und „Sterben verhindern“; meinen Sie nicht vielmehr, Sterben ermöglichen?
RM: Bei manchen mag es sein, dass der Sterbeprozess schon begonnen hat, wir das aber durch unsere technischen Geräte gar nicht erkennen können. Dadurch verhindern wir im schlimmsten Fall auch ein Sterben. Natürlich versuchen wir mit täglich drei Visiten unsere Arbeit permanent zu re-evaluieren. Wir überprüfen immer wieder aufs Neue, was das Therapieziel ist und ob durch unsere Maßnahmen diese Ziele noch erreicht werden können. Ganz konkret zum Beispiel: Müssen wir jetzt unbedingt noch diese Drainage legen? Ist das im Konsens mit dem Willen des Patienten? Machen wir das im Konsens mit unserem Team, mit der Familie? Und was ist das Ziel unseres Handelns? Können wir mit unseren Maßnahmen weiterhin ein kuratives oder ein definiertes Ziel erreichen, oder halten wir den Prozess und die Ziele womöglich gar nicht mehr ein oder verhindern sie gar. Die Therapieziele sind ja ganz individuell definiert. Wenn ich Sie fragen würde, wie stellen Sie sich die Qualität des Lebens nach einer Intensivtherapie vor, dann würden Sie vielleicht sagen: „Ich will selbstbestimmt leben, frei sein, mich noch bewegen können.“ Wenn die Möglichkeiten aber maximal auf eine Bettlägerigkeit und eine Langzeitbeatmung zu Hause hinauslaufen können, dann würden Sie möglicherweise sagen, dass Sie das nicht möchten. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass die Familie sagte, unser Vater wäre auch im Kreis seiner Mehrgenerationenfamilie glücklich, wenn er beatmet inmitten des Wohnzimmers in seinem Bett liegen könnte, und dadurch in einer sehr reduzierten Form noch am Leben seiner Familie teilnehmen würde. Bei den Therapiezielen gibt es ganz große und höchst individuelle Unterschiede.
HvE: Neben unseren technischen Hilfsmitteln verfügen wir durch unsere Erfahrungen mit Patienten auch über eine gewisse Intuition. Wir spüren häufig, dass trotz der Therapie ein Sterbeprozess einsetzt, auch wenn man das noch nicht fachlich und anhand von Laborwerten festmachen kann. Wenn sie täglich acht Stunden lang einen Patienten pflegen, versorgen, anfassen, dann können sie häufig – wie mit einem sechsten Sinn – erkennen, dass sich ein existenzieller Wandel beim Patienten vollzieht.
dp: Aufgrund Ihrer Erfahrungen und all den sinnlichen und technischen Informationen, die Sie bei der Pflege und der medizinischen Betreuung permanent wahrnehmen, entwickelt sich solch eine Intuition. Ich stelle mir vor, dass die Angehörigen, die zudem ja persönlich und emotional höchst verwickelt sind, Anzeichen des Sterbens oft nicht sehen können oder wollen.
HvE: Das ist ja genau der Punkt, warum die Angehörigen die Patienten täglich begleiten können, damit sie sie diese Veränderungen wahrnehmen und im Anfassen begreifen können. Genau diese Kontinuität hatten wir in dieser Corona-Pandemie nicht mehr. Es war ganz schwierig für Angehörige, alles nur am Telefon erzählt zu bekommen. Sie konnten sich kein eigenes Bild machen. Als sie dann kommen durften, waren sie oft erschrocken und sagten: „So habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Doch wir haben ihnen das so vermittelt. Wir mussten erkennen, dass allein die Sprache eben nicht ausreicht, um sich das Ausmaß einer Erkrankung vorstellen zu können.
RM: So ist es. Diesen Prozess in der letzten Phase des Lebens und dann aber auch des Sterbens, das zu begreifen, ist ja für uns schon schwer. Für die Angehörigen, deren Verlustängste und deren Trauer einsetzen, ist das um ein Vielfaches schwieriger.
dp: Wie ist eigentlich der Betreuungsschlüssel auf einer Intensivstation?
HvE: Eins-zu-zwei-Betreuung: Eine Pflegekraft hat zwei Patienten. Das muss auch so sein. Es gibt auch Phasen, in denen eine Eins-zu-eins-Betreuung notwendig ist, weil die Pflegekraft und ein Arzt den Patienten nicht allein lassen können.
RM: Beim Sterbeprozess ist im Grunde immer jemand am Bett. Wenn Angehörige allein mit dem Patienten sein möchten, ermöglichen wir das. Zugleich versuchen wir zu eruieren, ob es Angehörige auch allein durch die Phasen schaffen, in denen mal ein Alarm ertönt oder das Herz unregelmäßig schlägt. Wir versuchen sie immer darauf vorzubereiten, indem wir erklären, was im Sterbeprozess geschieht. Die Patienten machen vielleicht noch einmal einen tiefen Atemzug oder öffnen ihre Augen überraschend weit; dieses letzte Aufbäumen des Lebens, die Schnappatmung. Unser Ziel ist, dass die Angehörigen sich nicht erschrecken, dass sie ruhig bleiben können.
HvE: Wenn wir dabei sind, sehen wir ja, wie die Angehörigen sich verhalten. Dann können wir auch Einfluss nehmen, indem wir mit ihnen sprechen und sie dann häufig über ihre Beziehung zum Sterbenden zu erzählen beginnen. Dadurch wenden sie oft Blicke von den Geräten ab. Wenn man dann so ins Gespräch kommt, ja, das ist eigentlich sehr schön.
dp: Und dafür gibt es Raum?
HvE: Dafür schaffen wir Raum.
RM: Darf ich fragen, ob Sie sich zutrauen würden, jemanden beim Sterben zuhause zu begleiten?
dp: Es gibt ja tatsächlich immer mehr Letzte-Hilfe-Kurse, um immer mehr Angehörige auf solch eine Situation vorzubereiten. Ich habe bisher noch keinen Menschen dabei begleitet, habe aber mit einigen darüber gesprochen, die solch eine Erfahrung gemacht haben. Was sie beschrieben haben, was sie erlebt haben, hat sie oft gezeichnet. Das ist schon eine extreme Erfahrung, einen geliebten Menschen zuhause in den Tod zu begleiten, selbst wenn mobile palliative Teams Unterstützung bieten. Wenn ein Angehöriger dies alleine macht, und nicht wie früher üblich eine Mehrgenerationenfamilie, dann kann das schnell zu einer Überforderung werden.
RM: Das denke ich auch. Wahrscheinlich sind wir da schon in einer gesellschaftlichen Überforderung. Deswegen ist es fast schon wie eine Institutionalisierung, dass man sagt: Krankenhaus oder Hospiz. Viele Menschen trauen sich eine Sterbebegleitung zuhause nicht zu. Aber sie wissen, im Hospiz oder im Krankenhaus erfahren wir Unterstützung. Wie kann man das beschreiben? Mir fehlt der Ausdruck dafür, ich will es nicht technisch nennen, aber es ist koordiniert, es ist geplant.
dp: Es ist ritualisiert. Es sind nur eben andere Rituale. Sie sind eher technisch geprägt. Ich möchte gerne zur Covid-19-Pandemie kommen. Was hat sich dadurch geändert, also ganz konkret bei Ihrer Arbeit?
HvE: Unsere Intensivstation hat offene Besuchszeiten. Die Angehörigen waren immer sehr viel mit einbezogen. In der ersten Welle im Frühjahr 2020 durften sie nicht mehr ins Klinikum kommen, und das war schon eine schwierige Situation. Es gab ein Besuchsverbot.
Interessanterweise haben wir das zu Beginn gar nicht wahrgenommen. Wir waren so mit den Patienten beschäftigt, mit Corona, mit der Pandemie. Was macht das Virus? Was ist es für ein Krankheitsbild? Was macht es mit mir? Was macht es mit unseren Angehörigen, wenn wir alle noch keinen Impfschutz haben. Wir waren alle sehr beschäftigt, so dass das Fehlen der Angehörigen erst einmal nicht aufgefallen ist. Doch dann kam der Moment, in dem es uns sehr klar wurde, als die ersten Patienten starben und ihre Angehörigen nicht dabei waren. Das war für uns schon sehr schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Rituale, die wir auf Intensivstation haben – die Ärzte und die Pflegekräfte – weiterhin so durchgeführt. Die Patienten sind nicht allein gestorben, weil wir bei ihnen waren.
RM: Wir hatten hier einen Patienten aus Rumänien übernommen. Da haben die Kinder per Videotelefonie für den Vater gesungen.
HvE: Ja, das war in der zweiten Welle. Das war sehr schön. Da waren wir in der kurzen Zeit schon professioneller, so dass wir Video-Konferenzen angeboten haben. Das war ein junger Mann aus Rumänien, und wir haben mit den Angehörigen eine Sterbebegleitung über Zoom gemacht. Das war völlig neu für uns. Das war schon sehr berührend. Aber in der ersten Phase der Pandemie waren Angehörige gar nicht dabei. Dadurch hat sich unsere Arbeit verändert und auch die Sterbebegleitung. Das Seuchengesetz fordert übrigens auch, dass wir verstorbene Covid-Patienten in spezielle Leichensäcke legen und den Leichensack danach nochmals von außen reinigen. Das fühlte sich sehr befremdlich, den Patienten auf diese Weise durch eine Plastikfolie zu spüren. Da fragt man sich natürlich: Wie pietätvoll ist das, was ich da gerade mache?
RM: In der zweiten und dritten Welle war vieles schon anders. Wir mussten ja alle dazulernen. In der ersten Welle wussten wir wenig, und einige Mitarbeiter hatten selbst große Ängste. Meinen ersten Covid-Patienten habe ich in einem externen Krankenhaus an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, ohne zu wissen, dass er infiziert war. Die Anamnese war ganz anders. Er hatte eine Lungenvorerkrankung, hatte Husten, Schnupfen, Heiserkeit und war dann im freien Fall. Als wir erfahren haben, dass er Covid hatte, waren schon viele von uns ungeschützt im Geschehen. Wir wussten aus China, dass die Übertragung von Patient auf Pflegepersonal zu Beginn bei rund 30 Prozent lag und dass dort sehr viele Pflegekräfte auch verstorben sind, weil sie sich infiziert haben. In der zweiten und dritten Welle wurden die strikten Bestimmungen gelockert, weil wir gelernt hatten uns und auch Angehörige zu schützen. Wir konnten früher Antikörper bestimmen, so dass wir wussten, wenn Patienten nicht mehr infektiös waren. Durch unsere Erfahrungen hat sich niemand auf unserer Intensivstation infiziert: kein Personal und auch keine Angehörigen. Meist waren die Angehörigen ja selbst in Quarantäne, doch im Anschluss durften sie regelmäßig auf Station kommen.
HvE: Wir konnten wieder mehr mit den Angehörigen arbeiten, was allen guttat. Wir hatten auch tragische Situationen, in denen hier ein Patient und seine Schwester lagen. Beide sind verstorben und auch die Mutter verstarb an Covid. Das hat uns sehr belastet.
Normalerweise kommen Patienten nach einem Verkehrsunfall oder nach einer Not-Operation zu uns. Da haben wir häufig keine Beziehung zu dem Patienten. Die wird erst langsam über Gespräche mit den Angehörigen aufgebaut und wächst von Tag zu Tag. Durch Covid kamen Patienten, die uns selbst ihre Geschichte erzählten. Sie wurden wach und klar auf der Intensivstation aufgenommen, hatten schon viel gelesen und in den Medien gehört. Sie kamen zu uns und wussten, dass wir ihnen helfen möchten. Mit jedem Tag ging es ihnen aber meist schlechter, oft sehr viel schlechter.
dp: Sind die Covid-Patienten überraschender verstorben?
RM: In der Regel ist es so, dass wir bei den Krankheitsbildern, die wir kennen, eine gute Prognoseeinschätzung vornehmen können. Doch SARS-CoV 2 ist unberechenbar. Den einen erwischt es, ja und der kann auch erst 18 sein. Das kennen wir von den Virusgrippen so nicht. Bei Influenza konnte ich sagen, der Patient ist jung und wenn wir unser Bestes geben, dann verlässt er unsere Station wieder. Bei SARS-CoV-2 ist es viel schwieriger, weil das Virus neben der Lunge auch weitere Organsysteme, das Gehirn, Nieren, Leber, Magen-Darm-Trakt oder das Gerinnungssystem befällt. Selbst wenn die Therapie anfangs super verläuft, kamen zweite und dritte Wellen in der Erkrankung selbst, die alle Prognosen ad absurdum führten. Teilweise sind uns junge, durchtrainierte Patienten verstorben, die uns sonst nie versterben würden.
dp: Wie gehen Sie mit dieser Form der Belastung um? Gibt es ein System, das Halt bietet?
HvE: Ja, es gibt ein System, das uns ganz klar vermittelt, welche psychologische Hilfe wir uns holen können. Im Team wird vieles besprochen, auch werden Supervisionen angeboten. Als leitende Person in der Pflege erlebe ich, dass die Mitarbeiter viel über ihre Belastungen reden. Sie kommen zu mir ins Büro oder sprechen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Nach Gesprächen und Erholungsphasen geht es ihnen meist besser. Richtig schlimm war es allerdings in der dritten Welle. In dieser Zeit konnten wir den körperlichen und psychischen Stress kaum privat ausgleichen – so stark waren wir alle im Einsatz.
RM: Visiten sind hier ebenfalls ein wichtiges Standbein. Das Team besteht aus einem Oberarzt oder -ärztin, einem Assistenzarzt, oder -ärztin und einer Pflegekraft. Normalerweise geht die Stationsleitung auch mit. Hier werden dann feinfühlig die therapeutischen Ziele evaluiert und festgesetzt. Wenn für das Team, die Maßnahmen am Patienten stimmig, nachvollziehbar und transparent sind, dann kann dadurch schon vieles aufgefangen werden. Es gibt dennoch immer wieder Fälle, die einem nachhängen. Aber natürlich entwickelt man auch Schutzmechanismen, die einen davor bewahren. Wir können nicht jede Geschichte mit nach Hause nehmen.
dp: Für mich wirkt diese Pandemie wie ein Brennglas. Es wurden Probleme extrem sichtbar und auch spürbar, die jedoch schon zuvor existierten. Übertragen auf Ihre Tätigkeiten: Hat sich durch die Pandemie im Bereich Sterben und Tod auf der Intensivstation etwas verändert?
HvE: Mir wurde besonders in der zweiten und dritten Welle bewusst, wie wichtig unsere Arbeit mit den Angehörigen ist. Wir führen ja auch ein Patiententagebuch unter Einbeziehung der Angehörigen und der Patienten. Das haben wir in der ersten Welle nicht gemacht, weil wir da nicht mit den Angehörigen vorher reden konnten. Wir kannten sie ja gar nicht.
dp: Das Patiententagebuch beschreibt, was der Patient oder die Patientin während ihrer Erkrankung erlebt hat?
RM: Ja, aus jeglichen Perspektiven: Physiotherapeut, Pflegekraft, Ärztinnen oder auch Angehörige. Jeder der das Bedürfnis hat, über ein Erlebnis mit dem Patienten etwas aufzuschreiben.
HvE: Es geht dabei um nichts Medizinisches. Das Tagebuch ist für den Patienten, um diese Zeit später verarbeiten zu können oder für die Angehörigen, wenn der Patient sterben wird.
dp: Weil die Arbeitsbelastung zu hoch war?
HvE: Die Arbeitsbelastung ja, aber es hatte einfach noch nicht den notwendigen Raum dafür gegeben. Die permanente Information der Angehörigen war durch die besondere Pandemie-Situation einfach wichtiger. Auch die organisatorischen Strukturen sind da ja nicht so einfach. Papier oder andere Dinge konnten wir wegen des Infektionsschutzes nicht einfach den Angehörigen mitgeben. Um es nochmals zu betonen: Ich habe durch die Pandemie noch mehr verstanden, wie essenziell die Angehörigenbetreuung ist: für die Patienten, für die Angehörigen selbst, aber auch für die Mitarbeiter.
dp: Sie haben mir beim Rundgang über die Station den eigens für Abschiede von Ihrem Team eingerichteten Raum gezeigt. Das hat mich stark beeindruckt. Als das Krankenhaus vor vielen Jahrzehnten gebaut wurde, spielten solche Räume noch keine Rolle. Ist das die Zukunft, auch für die kommenden Pandemien: Abschiede ermöglichen, auch unter den Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes?
RM: In der zweiten und dritten Welle der Pandemie haben wir Abschiede ermöglicht. Die Angehörigen konnten mit Schutz ins Zimmer. Da hat sich für uns nichts geändert. Baulich haben wir die Strukturen geschaffen. Wenn wir jetzt neu bauen würden, dann würde man wahrscheinlich eine Super-Iso-Intensivstation mit besonderen Lüftungsanlagen, Hepa-Filtern etc. einrichten.
HvE: Ich finde, es geht auch um die Haltung. Das Bauliche ist das eine, das können wir ja teilweise nicht ändern. Ich finde, wir haben es gut gelöst, unter Einhaltung aller Regeln der Hygienemaßnahmen.
dp: Jetzt haben wir gesamtgesellschaftlich noch nie so viel über die Intensivmedizin gesprochen wie im letzten Jahr. Glauben Sie, dass dies einen positiven Effekt haben wird? Auch im Sinne einer Wertschätzung, dass also wahrgenommen wird, wie Ihre Arbeit für unserer Gesellschaft ist?
RM: Hoffnung haben wir, aber ich glaube das nicht. Es wurde ja so viel Geld ausgegeben, dafür mussten Schulden gemacht werden. Dass strukturell und personaltechnisch nun noch Ressourcen für Investitionen im Bereich der Intensivmedizin vorhanden sind, bezweifle ich. Ich rechne nicht damit, dass die Intensivmedizin nun einen anderen Stellenwert bekommen wird.
Vielleicht noch ein Satz zu Covid-19. Wir sind durch SARS-CoV-2 demütiger geworden. Wir können medizinisch viel machen, aber wir haben auch ganz klar gesehen, dass wir trotzdem Patienten an einen Virus verlieren. Covid-19 ist eine Krankheit, die viel Unheil gebracht hat. Wir haben alles versucht und haben trotzdem bei vielen schweren Verläufen, auch junge Patienten verloren, haben sie nicht heilen können. Ja, es ist schon viel Demut entstanden.
dp: Ich danke Ihnen sehr für dieses fundierte und persönliche Gespräch.
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
Zentralinstitut für Sepulkralkultur
Museum für Sepulkralkultur
Weinbergstraße 25–27
D-34117 Kassel | Germany
Tel. +49 (0)561 918 93-0
info@sepulkralmuseum.de