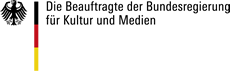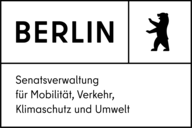FRIEDHÖFE AUS ALLER WELT
Wir sind auf der ganzen Welt unterwegs und berichten von der Bestattungs- und Friedhofskultur der Länder, Religionen und Kulturen. Die Fotoreisen werden für ihre besondere Aktualität oder Besonderheiten ausgewählt. Die hier gezeigten Sammlungen sollen transformative Prozesse und fortgeführte Traditionen dokumentieren. Die Fotografien und Reiseberichte gewähren so einen Einblick in die Vielfalt der Sepulkralkultur.
Der Tulpenfriedhof in Gönningen
Wahre Tulpenpracht
Jedes Frühjahr aufs Neue zieht ab Mitte April ein Meer blühender Tulpen auf dem Gönninger Friedhof Scharen von Besucher*innen an. Sowohl auf den Gräbern als auch auf Freiflächen entlang Wegen und auf Wiesen bieten Tulpen in unterschiedlichen Farben und Formen eine Augenweide. Viele Stellen in Gönningen sind von Tulpen geziert, und seit einigen Jahren gehört auch der Friedhof wieder dazu.
Die enge Verbindung zwischen Gönningen und Tulpen hat geschichtliche Gründe, über die das Samenhandelsmuseum im Gönninger Rathaus informiert. Der kleine Ort am Fuße der Schwäbischen Alb war vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein Zentrum für den Samenhandel. Zeitweise war fast die Hälfte der Bevölkerung europaweit und über Europa hinaus unterwegs, um Blumen- und Gemüsesamen sowie Tulpenzwiebeln zu verkaufen. Auch in der Heimat hatte man in Gärten an den Tulpen Freude und pflanzte die damals sehr wertvolle Tulpe auch auf Gräbern.
Jenseits privater Tulpenpflanzungen engagiert sich heutzutage der Verein Gönninger Tulpenblüte für das alljährliche Entstehen der Blütenfülle. Zudem findet vor allem der nicht weit vom Friedhof entfernt liegende Schaugarten des 1865 in Gönningen gegründeten Familienunternehmens Samen-Fetzer mit einem großen Sortiment aus Frühjahrsblühern, darunter viele Tulpensorten, das Interesse von Tourist*innen. Im Vergleich dazu ist der kleine Friedhof ein beschaulicher Ort, in dem die Tulpen in Ruhe „angewandt“ zu betrachten sind: Auf dem Friedhof setzen sie bürgerliche Gedenkkultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts fort, in der man den Verstorbenen mit aufwändigem und kostbarem Grabschmuck gedachte. Nebenbei partizipiert man mit den Tulpen auch noch am stolzen Selbstbewusstsein einer Gemeinde auf ihre spezifische und besondere Handelsgeschichte. Eine Herausforderung besteht sicherlich darin, die verschiedenen Aspekte dieses Friedhofs – als Ort persönlichen Gedenkens, als geschichtliches Zeugnis und als Magnet für Tourist*innen – in einer Balance zu halten, in der der erstgenannte Aspekt nicht übermäßig strapaziert wird.
Bericht: Dagmar Kuhle/ Fotos: Peter Trump
Der Friedhof Eichbühl in Zürich
Ein besonderes Gestaltungskonzept
Der Friedhof Eichbühl in Zürich ist ein außergewöhnlicher Friedhof. Dies liegt an seinem nahezu beispiellosen Gestaltungskonzept, an dem sich seit seiner Einweihung im Jahr 1968 die Geister scheiden. Unabhängig vom einzelnen subjektiven ästhetischen Urteil ist das Konzept in jedem Fall eines: radikal!
Der Friedhof befindet sich im Züricher Westen, im Stadtteil Altstetten. Er ist am nördlichen Ausläufer der Albiskette, dem Uetliberg, gelegen. Was ihn so radikal und damit so augenfällig macht, ist seine höchst sparsame Betonarchitektur inmitten einer weitläufigen Naturlandschaft, woraus sich ein überaus spannender Kontrast speist.
Die wichtigsten architektonischen Bauten – Eingangsterrasse mit Aufbahrungshalle, Kapelle, großer Pavillon mit Bassin – sind so angeordnet, dass sie im Landschaftsbild ein imaginäres Dreieck formieren und sich sogleich auf unterschiedlichen Höhenniveaus befinden.
Nicht minder markant sind die sechs großen, in den Hangfuß hineingeschnittenen Grabfelder, die – von Mauern umgeben – intime Grabräume bieten (sollten). Über die vielen Jahre hinweg hat sich jedoch gezeigt, dass die Auslastung des Friedhofs unter den einstigen Erwartungen – seinerzeit ergaben Hochrechnungen einen Bedarf von 18.000 Gräbern – weit zurückblieb.
Die von den Architektenteams Hans Hubacher und Ernst Studer (Architekten), Ernst Graf und Fred Eicher (Landschaftsarchitekten) sowie von dem Bildhauer Robert Lienhard entworfene und gestaltete Anlage wurde 1985 mit einem neuen Pflanzkonzept versehen. Es sah zusätzliche Bäume, Sträucher, Hecken und Stauden vor mit dem Ziel, die Strenge der Anlage zu durchbrechen und das Areal ökologisch aufzuwerten. Zwei Jahrzehnte später wurde davon wieder Abstand genommen (2005), sah man es doch nun als erstrebenswert an, die radikale Klarheit des ursprünglichen landschaftsarchitektonischen Entwurfs wieder erlebbar zu machen. Die 1987 angelegte Lindenallee, welche man auf direktem Weg von der Eingangsterrasse zum Pavillon passiert, blieb von der Konzeptbereinigung allerdings – man könnte durchaus sagen: glücklicherweise – ausgenommen.
Die konzeptverändernden und -bereinigenden Maßnahmen haben über die Jahre hinweg immer wieder für Diskussionen gesorgt. Dies unterstreicht einmal mehr, dass es sich bei dem Friedhof Eichbühl um eine ganz besondere Anlage im Dienst der Letzten Ruhe handelt. Sie offenbart einen höchst eigenwilligen und damit höchst außergewöhnlichen Charme, was einen Besuch in jedem Fall aber empfehlenswert macht.
Fotos: Ulrike Neurath
Weißer Marmor und Kunstblumen
Der Griechisch-Orthodoxe Friedhof auf Mykonos
Der Griechisch-Orthodoxe Friedhof auf der Kykladen Insel Mykonos liegt, wie fast alle griechischen Friedhöfe, außerhalb des Ortes, am Rande des kleinen Ortes Ano Mera in der Inselmitte. Zu sehen sind sehr schöne und aufwendige Marmor Grabmäler mit großen weißen Grabplatten und interessanten Skulpturen, teils mit einem Glaskasten, in dem Kerzen, Fotos und Andenken an die Toten zu sehen sind. Eine wunderschöne Marmorlandschaft für ober- und unterirdische Gräber und unterschiedlichstem Grabschmuck mit Porträtfotos. Frische Blumen sind allerdings so gut wie nie zu finden, sondern ein Blumenmeer aus Plastikblumen oder Kränzen, was aber nicht heißt, dass die Angehörigen die Grabstätte nicht besuchen. Regelmäßige Grabgänge sind hier genauso üblich wie in Deutschland. Wie üblich gibt es auch hier eine kleine griechische Kapelle, die für die Aufbahrung und Aussegnung genutzt wird. Da in Griechenland Feuerbestattungen unüblich sind (legalisiert 2006), sieht man auch hier ausschließlich Erdbestattungsgräber. Die Knochen werden nach drei bis vier Jahren aus dem Grab entnommen, gewaschen, gereinigt und mit Rotwein übergossen. Dann werden sie gebündelt, in Stoff eingewickelt oder in ein Gefäß gegeben und in eine Nische mit Namensplatte in der Familien-Kapelle oder in den sogenannten Gebeinhäusern weiter aufgebahrt. Die Erdbestattung ist also nur ein Zwischenakt.
Fotos: Achim Eckhardt
Der Friedhof von Porreres, MALLORCA
Grabnischen und Gruftgräber
Betritt man den Friedhof des rund 5500 Einwohner zählenden mallorquinischen Ortes Porreres, fällt sofort die buchstäblich vielseitige Architektur und Formensprache bei einem nahezu einheitlichen Farbbild auf. Die Gebäude sowie Gräber und Grabbauten haben einen gelblichen Farbton, ganz so wie viele Häuser des Ortes selbst, bei denen es sich um Sandstein-Bauten handelt. Stimmig fügt sich alles in die umliegende Landschaft ein, die insbesondere im heißen Spätsommer dieser Farbstilistik folgt.
Der Friedhof von Porreres ist vor allem bei herrlichem Wetter eindrücklich. Dies liegt nicht allein an der Herrlichkeit von Sonnenschein und blauem Himmel an sich, sondern daran, dass dadurch ein gewaltiger Farbkontrast entsteht, wodurch die Ruhestätten der Toten auf faszinierende Weise zur Geltung kommen. Neben vielen Einzel-, vor allem aber Familiengräbern, die mit Grabplatten abgedeckt sind (Gruftgräber), gibt es unter- und oberirdisch angelegte Kolumbarien bzw. Grabnischen, außerdem zahlreiche Gruftbauten. Letztere sind Familiengrabstätten, die mit je einem schmalen Eisentor verschlossen sind und ebenfalls mehrstöckige Grabnischen enthalten. Indem diese Grabbauten zum Teil das Friedhofsareal säumen, erinnern sie an einen Camposanto, d.h. an einen Friedhofstyp, dessen oberirdische Gruftkammern hofartig das gesamte Begräbnisareal umschließen. Der klassische Camposanto hat zudem einen sich zum „Hof“ hin öffnenden Bogengang – alternativ eine Kolonnade –, was auf den Friedhof von Porreres in dieser Form jedoch nicht zutrifft.
Bei aller Dominanz des sandsteingelben Farbtons gibt es dennoch auch andere Farbtupfer, obgleich sehr reduziert. Diese werden von diversen Grabaccessoires gebildet, die lediglich auf einigen Kindergräbern etwas üppiger ausfallen. Farbtupfer rekrutieren sich außerdem aus dem ebenfalls meist übersichtlich platzierten Blumen- und Pflanzenschmuck. Vor allem sind es kleine (Kunst-)Blumensträuße, die die Grabnischen zieren, wo sie direkt an deren Frontplatte fixiert oder aber in dort befestigte Gefäße bzw. Vasen hineingegeben werden.
Im Jahr 2016 erregte der Friedhof von Porreres Aufmerksamkeit über Mallorca hinaus, da auf ihm ein Massengrab mit den Überresten von 71 Personen gefunden worden war. Bei den Toten handelte es sich um „Republikaner“, d.h. um die Anhänger einer demokratisch gewählten Regierung der sog. Zweiten Spanischen Republik, die während des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) von rechtsgerichteten „Nationalisten“ hingerichtet wurden.
Fotos: Ulrike Neurath
WeiHnachtliche Friedhöfe auf Island
Akureyri im Norden und Borganes im Westen
Tageslicht ist auf Island im Winter ein rares Gut. Dafür ist die künstliche Beleuchtung in Ortschaften und Städten allgegenwärtig seit man die Natur als Energieerzeugung zu nutzen verstanden und perfektioniert hat. Auch Friedhöfe sind durch Straßenlaternen hell erleuchtet. Ungewöhnlich ist es für ausländische Besucher*innen eher, dass zur Weihnachtszeit auch die einzelnen Gräber mit elektrisch leuchtenden Kreuzen geschmückt werden.
Auf neueren Friedhöfen, wie zum Beispiel dem Friedhof oberhalb der Stadt Akureyri (isländische sog. „Hauptstadt des Nordens“, 90km südlich des Polarkreises), wird der Friedhof in ein leuchtendes Gesamtkunstwerk verwandelt – mit vielen vorhandenen Steckdosen und einer Gestaltungsvorgabe bezüglich der zu verwendenden Kreuze.
Auf dem Friedhof des kleinen Ortes Borganes (70km nördlich von Reykjavík) hingegen leuchten die unterschiedlichsten Kreuze vor den Gräbern, eine Gestaltungsvorgabe gibt es hier nicht. Und bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein ziemlich improvisiertes Kabelgewirr zwischen den Grabsteinen.
Die Herkunft dieses Brauches ist nicht abschließend geklärt. Es wurde allerdings schon vor Einzug des Christentums auf Island, wie auch in weiteren skandinavischen Ländern, der kürzeste und damit dunkelste Tag des Jahres (21. Dezember) mit einem „Lichterfest“ gefeiert. Zu diesem Datum, ab dem die Tage wieder länger werden, wurden alle Häuser mit Öllampen und Kerzen geschmückt. Da erscheint es naheliegend, die Toten ebenso mit Lichtern zu ehren. Auch in Norwegen ist es übrigens heute noch üblich, zu Weihnachten brennende Kerzen an den Gräbern aufzustellen.
In den rauen Verhältnissen des isländischen Winters, der vor dem Klimawandel von Oktober bis April noch eine geschlossene Schneedecke und sehr viel Wind mit sich brachte, setzten sich die ersten elektrischen Varianten des Grabschmucks auf den Friedhöfen schnell durch. Wer also um die Weihnachtszeit durch ein dunkles Island reist, wird allerorten von buntem Leuchten herzlich gegrüßt und an die ruhenden Toten erinnert.
Fotos: Michael Göbel
Der Cemitério dos Prazeres
"Friedhof der Freuden"
Der Cemitério dos Prazeres ("Friedhof der Freuden") ist der beeindruckendste „Totenacker" der portugiesischen Hauptstadt. Der 1833 nach einer Cholera-Epidemie angelegte Friedhof ist eine Begräbnisstätte für Aristokraten sowie großbürgerliche Intellektuelle und Künstler*innen. Er liegt im Westen der Stadt und zeichnet sich durch seine überirdischen Grüfte aus, den sogenannten Begräbnisvillen, die in Straßen und Alleen angeordnet sind. Sie sind abgeschlossen, jedoch bieten sie den Angehörigen die Möglichkeit einzutreten, um an kleinen Altären in Gegenwart der offen aufgestellten Särgen ihre Toten zu betrauern. Die Nähe zu den Verstorbenen beeindruckt, macht sie doch deutlich, dass sie nicht als bedrohlich, unhygienisch oder störend wahrgenommen wird. Ganz im Gegenteil: Sie offenbart die Verbindung der Lebenden zu den Toten.
Fotos: Dirk Pörschmann
Reise durch Bosnien und Herzegowina
Kriegsgedenken und konfessionelle Grabfelder
Serb*innen, Kroat*innen und Bosnier*innen leben im bosnischen Br?ko-Distrikt an der Grenzregion der drei Länder eng beieinander. Bei der Reise quer durch die Region Br?ko wechseln sich muslimische, katholische und serbisch-orthodoxe Friedhöfe ab. Und damit meist auch weiße Steinstelen der muslimischen Bevölkerung und schwarze Grabsteine mit Fotogravuren aus dem Leben der Verstorbenen auf den christlichen Friedhöfen.
Ein kleiner Friedhof nahe Br?ko mit hauptsächlich serbisch-orthodoxen Gräbern liegt zwischen Feldern und Hügeln. Auf den Vorderseiten der rot-schwarzen Grabsteine sind oft kleine Emailleplatten mit Porträt-Fotos der Verstorbenen angebracht, auf den Rückseiten große fotorealistische Gravuren aus dem Alltag – mit Musikinstrument, Flinte oder Tasse in der Hand. In den Metallhäuschen neben den Familiengräbern liegen Reste vom Anzünden der mitgebrachten gelben Kerzenstäbchen und von Weihrauch und Kohle.
Auf dem Bare Friedhof in Sarajevo hingegen liegen die unterschiedlichen Bestattungstraditionen eng beieinander. Der 1962 eröffnete Friedhof ist einer der größten Europas. Er erstreckt sich – nach Konfessionen aufgeteilt – über die Hügel nahe der Stadt und gibt ein Bild der Gräber-Vielfalt und auch der Opfermassen der Jugoslawienkriege. In der Mitte stehen im Halbkreis angeordnete, organisch wirkende Kapellen für die Angehörigen der jeweiligen Konfessionen zur Verfügung – muslimisch, orthodox, atheistisch, katholisch und jüdisch. Eigene Gräberfelder gibt es zudem noch für Adventist*innen, Evangelist*innen und Altkatholik*innen. Auch hier finden sich die schwarz-roten Grabsteine auf den Feldern der katholischen und orthodoxen Bevölkerung. Aber auch Grabsteine mit Fotogravuren und dem Halbmond des Islam stehen dort verteilt. Die Grenzen zwischen den Bestattungstraditionen sind bei genauerem Blick manchmal fließend. Was sich beim Verlassen oder Hineinfahren in die Stadt aber am stärksten einprägt, sind die endlosen Gräberreihen der Opfer der Jugoslawienkriege.
Fotos: Tatjana Ahle
Reise zur isle of Lewis
Zwischen Himmel und Meer
Die drei Anlagen von Callanish (auch Calanais) bilden die größte heute bekannte Steinformation der Megalithkultur auf den britischen Inseln. Sie stammt aus der Bronzezeit (ca. 5000 v. u. Z.) und besteht nicht aus einem Kreis, sondern aus mehreren in sich verwobenen Formen. Der größte Monolith ist 4,5m hoch. Der Sinn hinter der Erschaffung der Steinformation liegt im Dunkeln. Die populärste Theorie besagt, dass sich die Steine auf den Verlauf des Mondes beziehen. Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit auf den Äußeren Hebriden, ist Callanish weniger bekannt als Stonehenge, jedoch besser zugänglich. Die Besucher*innen kommen – im Gegensatz zum abgesperrten Stonehenge – direkt an die Steine heran und der Zutritt ist (noch) kostenlos.
Der Friedhof von Bosta auf der Great Bernera Halbinsel der Isle of Lewis beherbergt wie so viele Orte in Schottland Kriegsgräber. Sie wurden von der Commonwealth War Graves Commission gekennzeichnet, die sich für diese Gräber verantwortlich zeichnet. Die Gräber der im Ersten und Zweiten Weltkrieg Gefallenen sind besonders geschützt.
Direkt am Meer liegt einer der Friedhöfe der Bhaltos Halbinsel. Viele Friedhöfe auf den Äußeren Hebriden zeichnen sich durch die Begrenzung durch eine Steinmauer aus. Sie liegen häufig außerhalb der Dörfer. Da auf den Hebriden das Meer nicht weit ist, haben sie oft einen Strand in der Nähe und einen wunderschönen Blick aufs Meer.
Fotos: Isabel von Papen
mehr zur Isle of Lewis
Die Äußeren Hebriden sind Inseln 60km vor der Westküste Schottlands, die sich wie auf einer Perlenkette über 208km durch den Atlantik ziehen. Die nördlichste und gleichzeitig größte dieser Inseln ist die Isle of Lewis, die zusammen mit der Isle of Harris eine Doppelinsel bildet. Da Harris durch ein Gebirge getrennt ist, haben die Menschen ihnen zwei Namen gegeben. Insgesamt leben 18.500 Menschen auf der Insel. Ihre Sprachen sind sowohl Englisch als auch Schottisches Gälisch. Der Hauptort von Lewis ist Stornoway. Im Gegensatz zu den weiter südlich gelegenen Hebrideninseln, hat Lewis eine Presbyterianische Tradition (Protestantisch), die bis heute klar auf die Einhaltung des Sabbaths pocht: An Sonntagen steht das öffentliche Inselleben still.
Eine Rundreise durch Mexiko:
An der Route 180 zwischen Campeche und Palenque direkt am Golf von Mexico liegt ein kleiner Friedhof
Auf dem kleinen farbenfrohen Friedhof finden sich Grabanlagen neueren und älteren Datums. Darunter sind schön gestaltete Einzel-Gräber oder einfach gehaltene, oft auch mit mehreren Grabkammern übereinander. Die neueren Einzelgräber sind meist gefliest und haben ein Fenster oder eine kleine offene Kammer. Nach oben schließen viele mit einem Kreuz oder einem Engel ab. Zwischen den einfachen Gräbern gibt es nur festgestampfte Wege. Man sieht ihnen das heiße Klima an, denn sie sind stark verwittert. Zwischen den teurer wirkenden Grabmalen im Haupteingangsbereich führen gepflasterte Wege entlang. Was vor allem auffällt, ist die wundervolle farbige Gestaltung der Gräber. Ganz, als ob einem auch hier das mexikanische Leben entgegen leuchtet, nicht der Tod. Überall findet man Reste des Mexikanischen Totenfestes, dem Diá de los Muertos, das jedes Jahr Anfang November gefeiert wird. Zu diesem Festtag verbringen die Lebenden mit der ganzen Familie die Nacht am Grabmal ihrer verstorbenen Angehörigen, um über sie zu sprechen und sich Geschichten zu erzählen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Sie schmücken die Gräber prunkvoll mit Blumen und Kerzen und haben Gaben für ihre Angehörigen dabei. Dazu gehören Pan de Yema, das Hefegebäck, das den Toten Kraft geben soll bei ihrem Weg zu ihren lebenden Angehörigen, sowie Schokolade und Zuckerschädel, um sie zu stärken und Kerzen um ihnen den Weg zu leuchten. Es wird gemeinsam gegessen, Mezcal getrunken und darauf gewartet, vom Geist der lieben Verstorbenen berührt zu werden.
Fotos: Regina Oesterling
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
Zentralinstitut für Sepulkralkultur
Museum für Sepulkralkultur
Weinbergstraße 25–27
D-34117 Kassel | Germany
Tel. +49 (0)561 918 93-0
info@sepulkralmuseum.de