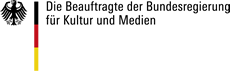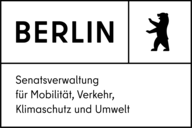„Das fand ich toll, ein Leben zu übersetzen in ein Objekt!“
Steinmetz, Bildhauer und Künstler: Michael Spengler ist Vermittler zwischen Leben und Tod
Auf einem kleinen Werkstattgelände in Berlin Mitte, zwischen ausgebautem Schiffscontainer und restauriertem Zirkuswagen hat sich Michael Spengler seinen Traumarbeitsplatz geschaffen. Hier zeichnet er mit Materialien wie Stein, Holz und Metall das Leben von Verstorbenen nach. Er erschafft in Handarbeit einzigartige Grabmale „denkwerke“, wie er sie nennt, die sich von der Masse abheben und ein persönlicher Ausdruck der Verstorbenen sein sollen. Wir haben das Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal porträtiert.
Direkt nach dem Abitur hat Michael Spengler genug von der Theorie. Er möchte etwas mit eigenen Händen erschaffen. Schlussendlich wird es die Ausbildung zum Steinmetz. Denn das Material Stein habe ihn durch seine Widerspenstigkeit schon immer fasziniert, so Spengler. 1963 in Itzehoe geboren zieht es den jungen Steinmetz nach seiner Lehre und seinem Zivildienst dann nach Turin. Hier studiert er an der „Accademia Albertina di Belle Arti“ Bildhauerei. Turin sei damals der Standort für moderne und intellektuelle Kunst gewesen, schwärmt Spengler. In der „Arte povera“ sei die Materialauswahl und Formensprache der Kunstwerke neu überdacht worden. Endlich konnte sich der junge Bildhauer in seinem Studium vom, wie er sagt, „Renaissance-belasteten“ Handwerk abgrenzen. Diese Studienzeit scheint ihn stark geprägt zu haben. Denn er merkt, dass er sich nach seinem Bildhauer-Diplom in seinen fünf Jahren als angestellter Denkmalpfleger in Ost-Berlin und selbst in der anschließenden fünfjährigen freiberuflichen Steinrestauratorenkarriere nie wirklich angekommen fühlt. Erst mit der Gründung seiner Firma „denkwerk“ im Jahr 2000 schließt sich der Kreis. Inspiriert durch einen Aufenthalt in Bern und durch den Steinmetz Roman Greub, fand Spengler nun seine Passion. Individuell gestaltete Grabsteine. „Das fand ich toll, ein Leben zu übersetzen in ein Objekt!“, erinnert er sich.
Den Firmennamen „denkwerk“ leitet Michael Spengler von dem Prozess ab, wie durch ihn Grabsteine entstehen. „Vor dem eigentlichen Werk steht ja ein längerer Prozess des Reflektierens“, also ein ausführliches Gespräch, was Spengler mit den Zugehörigen der Verstorbenen in seinem Büro im Zirkuswagen führt. Die Schwierigkeit sei es dann, aus dem vielschichtigen Leben einer verstorbenen Person die Essenz herauszuarbeiten und die dann in ein dreidimensionales Objekt zu übersetzen. Hierbei nimmt er bewusst nicht (nur) Aufträge an, die prominente und bekannte Personen betreffen. „Mich interessiert gerade der ‚Mensch von nebenan‘. Ein Mensch, der scheinbar unspektakulär gelebt hat. Dass man dann sieht, dass das ein ganz besonderer Mensch gewesen ist“, fasziniert Spengler an seiner Arbeit besonders. Dabei sehe er sich selbst in seiner Arbeit als etwas „Zwittriges“: als Handwerker, Künstler aber auch als Psychologe. Hatte er in seinen vorherigen Arbeitsverhältnissen nie wirklich „seine Formensprache“ gefunden, konnte er nun für seine denkwerke aus dem Vollen schöpfen. Hier schränkt ihn keine Stilrichtung ein.
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal sei er 2001 genau aus diesem Grund geworden: In der Arbeitsgemeinschaft würde Sepulkralkultur als etwas ganz Anderes, etwas Vielfältiges betrachtet. Inspiriert zu seinem Beitritt hätten ihn vor allen Dingen die Zeitschriften des Vereins. „Ich entsinne mich da noch an einen Satz aus einer Zeitschrift: ‚Nehmen Sie ihren Tod persönlich!‘. Frech, aber auch irgendwie wahr!“, beschreibt Spengler den ersten Kontakt mit der Vereinszeitschrift. Für ihn sei der Verein und das dazugehörige Museum mit Bibliothek eine Verbindung aus Tradition und neuer mutiger Sepulkralkulturforschung und Vermittlung. Spengler selbst sieht sich, diese Tradition fortführend, auch als Vermittler. So baute er beispielsweise einen alten Leichenwagen zur fahrenden Galerie aus. Alte Technik und Fahrzeuge hatten ihn schon als Kind fasziniert. Auch hier beschäftigte ihn offenbar schon früh die „Aufarbeitung“ des Vergänglichen. Als er dann den alten Volvo entdeckte, war für ihn sofort klar: Das wird die Bühne für seine Kunstwerke! Durch die großen gläsernen Scheiben der sogenannten „Galerie im Schneewittchensarg“ können Interessierte nach dem Umbau nun kleine Ausstellungsstücke zum Thema Leben, Liebe und Tod betrachten. So macht Spengler mit diesem und weiteren Kunstwerken und Installationen nicht nur auf seine Firma denkwerk aufmerksam, sondern er fördert das Nachdenken der Lebenden über den Tod. Der Steinmetz, Bildhauer und „denkwerker“ fasst zusammen: „Wenn die Lebenden sich öfter mit dem Tod auseinandersetzen würden, wären sie vermutlich bessere Menschen. Die Erfahrung, dass am Ende nichts festgehalten werden kann, hilft einem, schon zu Lebzeiten großzügiger abzugeben und dem eigentlichen Sinn, den wir alle im Leben suchen, näher zu kommen.
Text: Maja Böhme
Maja Böhme ist studentische Praktikantin im Museum für Sepulkralkultur. Sie studiert zurzeit im 3. Semester den Masterstudiengang „Geschichte und Öffentlichkeit“ an der Universität Kassel.

Werkstück 1: Ein denkwerk für André Krüger
In seiner Jugend sympathisierte André mit den Ideen und Zielen der RAF. Studiert hatte er dann Psychologie. Als begeisterter Ornithologe fand er Entspannung und Frieden in der Beobachtung der Natur. Auf dem Sterbebett fasste er einen klaren und für sein Umfeld schwer enträtselbaren Entschluss: Er konvertierte zum Katholizismus. Das denkwerk für Andre Krüger nimmt Bezug auf diesen späten Wechsel zum Glauben und seinen Eintritt in die katholische Kirche. Es ist ein Kreuz aus dickem Eichenholz. Der Querbalken ist allerdings sehr kurz ausgefallen. Oberhalb des kurzen Querbalkens sind direkt ins Eichenholz zwei Nistkästen für Vögel eingearbeitet. Bald schon waren zwei Meisenpärchen in Andrés denkwerk eingezogen.
Material: Eichenholz und Messing, Ort: Friedhof an der Heerstrasse in Berlin
Werkstück 2: Ein denkwerk für Reinhard Joseph
Reinhard Joseph war Bühnenmeister bei den Münchner Kammerspielen. Als „einer vom Schnürboden“ konnte er handwerklich eigentlich alles. Er kannte sich mit elektrischen Schaltungen aus, mit Metall, mit Holz oder mit Styropor. Sogar Wolken konnte er machen. Er kannte die Hebelgesetze und wusste, wie man schwere Dinge von oben herab auf der Bühne und durch die Luft bewegt. Als ihn die Liebe nach Berlin verschlug, kündigte er seine Festanstellung und wurde Hausmann in einer Patchworkfamilie. Er sorgte dafür, dass der Kühlschrank immer zum Bersten voll war. Er kochte gern reichlich. Seine Falafel waren legendär. Er fühlte sich für seine große Familie verantwortlich und liebte die Urlaube mit Fahrrad, Rucksack und Zelten.
Das denkwerk für Reinhard Joseph besteht aus einem Kalkstein, der in zwei Teile gebrochen wurde. Ein hoher Eisenrahmen verbindet beide Einzelteile. Mit dem unteren Stein ist der Eisenrahmen fest verbunden. Der obere Stein kann durch eine Führung im Rahmen bewegt werden. Ein Flaschenzug aus dem Theater ist mit dem oberen Stein verbunden. Zieht man an dem Stahlseil, bewegt sich der schwere Stein nach oben, dehnt die Zeit und gibt einen Spalt frei.
Idee und Ausführung: denkwerk in Zusammenarbeit mit der großen Familie; Material: Jura- Kalkstein; Corten- Stahl, Flaschenzug und Stahlseil; aufgestellt im Oktober 2019 auf dem Georgen Parochial- Friedhof an der Greifswalder Straße in Berlin
Beide Texte: Michael Spengler


Zufalls-Bestatter und Totentanz-Verfechter
Henry Schuhmacher ist Präsident der Europäischen Totentanz-Vereinigung
Am Schlagzeug sitzend und auf dem Becken trommelnd. So würde Henry Schuhmachers Totentanzfigur aussehen. Wenn es diese gäbe, würde er sie in das Register der Europäischen Totentanz-Vereinigung aufnehmen, dessen Präsident er ist. Ein Porträt über einen Bestatter, der immer zum falschen Zeitpunkt kam.
„Ich bin ein Musikfan. Am liebsten Ostrock. Karat, Puhdys, Klaus Renft Combo, Engerling. Früher zwei Konzerte in der Woche. Heute auch noch viele, aber nicht mehr ganz so oft." Henry Schuhmacher sucht die Kultur und die Gesellschaft. Früher war er regelmäßiger Gast im Leipziger Musikclub Tonelli oder im Anker, einer soziokulturellen Einrichtung. „Ich brauche den Austausch mit den Menschen und mache mir so meine Gedanken", sagt Schuhmacher. Das habe sich bis heute nicht geändert.
Neben einem Zufall hatte ihn auch das Interesse am Kontakt mit Menschen zum Beruf des Bestatters geführt. 32 Jahre lang stellte er sich dort auf immer neue Situationen ein. „Manche Sterbefälle haben seine guten Seiten. Aber insgesamt war die Arbeit nicht immer angenehm, weil der Anlass eben kein schöner war.“ Jüngst habe er seine Firma in gute Hände abgegeben. Seine eigenen Kinder hätten die Übernahme des Betriebs nicht in Erwägung gezogen, dafür seien sie vom Arbeitspensum ihres Vaters zu sehr abgeschreckt gewesen. „24/7 und das mal 52 – da nimmt keiner Rücksicht auf dich: Der Tod ist nicht planbar, dem kann man sich dann eben auch als Bestatter nicht entziehen.“ Schuhmacher sei allerdings auch schon immer jemand gewesen, der die Herausforderung mochte. Als junger Mann drückte sich das in seinem Hang zum Leistungssport aus. Von seiner damaligen Sportlehrerin angefixt, trainierte er ab der dritten Klasse Volleyball und schaffte es bis in die dritte Liga. „Mit 14 Jahren war ich mit meinen 1,81 Metern groß, doch mit 21 dann leider zu klein.“ Nur deshalb verfolgte er die Karriere als Leistungssportler nicht weiter.
In Leipzig geboren und aufgewachsen, absolvierte er dort auch sein erstes Studium. Als Ingenieur für Gießereitechnik, ein damals noch seltener Beruf, arbeitete er viel für Künstler. 1976 ging er zusammen mit seiner Frau, die er mit 20 kennengelernt hatte, nach Dresden, lebte dort fast 40 Jahre. Nach einer Anstellung bei der Stadt Dresden studierte er in den 1980er-Jahren im Fernstudium Staats- und Rechtswissenschaften. Auch sein Sohn und seine Tochter, heute 40 und 44 Jahre alt, kamen in Dresden zur Welt und 1991 machte er sich dort als Bestatter selbständig. Das habe der Zufall so gewollt. So erzählt der 68-Jährige von einem Ausflug nach Berlin 1990. In seiner Mittagspause mit Bratwurst wurde er überrascht von Starkregen. Sich unter nahegelegenen Arkaden eines Rathauses die Zeit vertreibend schaute er sich um und stellte fest, dass sich dort gleich mehrere Bestatter befanden. In Dresden hatte es zu diesem Zeitpunkt allein ein Bestattungsinstitut gegeben. So füllte er eine Marktlücke und gründete wenige Monate später das zweite in Dresden.
Dass das Gespräch über die Endlichkeit stetig weitergeführt werden muss, brachte ihn damals auch dazu, eine Galerie zu eröffnen. Als Bestatter sei er immer entweder zu früh gekommen oder zu spät: „Besuchte ich die Menschen für Gespräche über Bestattungsvorsorge, wollten sie noch nichts davon wissen. Wenn ich als Bestatter gerufen wurde, war bereits jemand gestorben.“ Die Galerie, die er 15 Jahre lang als Hobby neben seinem Beruf betrieb, hatte auf 300 Quadratmetern eine Ausstellungsfläche und eine kleine Bar für Gespräche.
Die Galerie gibt es heute nicht mehr. Statt dort, sitzt Henry Schuhmacher heute in Kneipen und besucht Stammtische anderer Vereine, etwa solche, die am Mittelalter interessiert sind. Es ist einer seiner Wege, neue Mitglieder für die Europäische Totentanzvereinigung (ETV) zu gewinnen. 2004 war er dem Verein als Mitglied beigetreten. Während seine Frau gern tanze, habe er das Totentanz-Sujet für sich entdeckt, merkt er mit einem Augenzwinkern an. Immer schon habe er sich auf Friedhöfen besonders für die Ornamente interessiert. Auch merkt man in der persönlichen Begegnung schnell: Schuhmacher ist einer, der den Menschenkontakt schätzt und eine Gelassenheit für Austausch mitbringt. Und: er möchte das Gespräch über Endlichkeit pflegen.
Das Totentanz-Sujet sei ein guter Botschafter für die Endlichkeit: Jeder werde geholt. Zeitpunkt unbestimmt, aber sicher. „Wer sich gut auf den Tod vorbereitet, der geht leichter über das Sterben in den Tod. Und der schätzt auch seine Lebenszeit anders." Er selbst habe auch einen Prozess hinter sich, erzählt er. "Ich habe mich in den vergangenen Jahren verändert, fahre jetzt nicht mehr 180 mit dem Porsche, sondern 120 mit dem Skoda." Wer zu Lebzeiten über den Tod nachdenkt, geht mit weniger Fragen in den Tod. Damit sei auch das Sterben weniger belastet. Und wann dieses beginne, wer wisse das schon? „Das ist ja das Prickelnde daran: der Tod ist immer zeitlos, es gibt keinen festgelegten Zeitpunkt.
Über die Totentanz-Vereinigung will Henry Schuhmacher Gedanken wie diese in die Öffentlichkeit bringen. Aber sein Interesse gilt auch dem historischen Blick. Die erste Totentanzdarstellung ist 1436 überliefert worden. Wie ist der Totentanz in den Köpfen der Menschen entstanden? Wie kam er nach Europa? Was kann das Totentanz-Sujet heute leisten? Das sind Fragen, die ihn seit 2021 auch als Präsidenten der ETV beschäftigen. „Ich betrachte den Totentanz als Denkmodell für die Auseinandersetzung mit dem Tod, aber auch als Mittel zur Traumaarbeit." So könne man anhand des Totentanzes über den Ukrainekrieg sprechen und Soldaten könnten ihn nutzen, um ihre Kriegserlebnisse zu verarbeiten.
Die Europäische Totentanz-Vereinigung ist die Einzige, die sich mit dem Totentanz beschäftigt. Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist das Führen eines Registers. Ihre derzeit 130 Mitglieder kommen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen, viele Künstler, aber auch Mediziner und Galeristen sind dabei und einige Mitglieder leben im Ausland. Auch der Vorstand, schwärmt Schuhmacher, komme aus unterschiedlichen Richtungen. Die Heterogenität sorge dafür, dass fruchtbarer Austausch stattfinde. „Mitglieder sind eben das Wichtigste am Verein. Ohne sie kein Dialog. Und den brauche ich." Deshalb sei er auch hinterher, regelmäßig Veranstaltungen zu organisieren: Exkursionen, Künstler-Besuche und Vorträge. 2023 fand anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins eine große Tagung in der Totentanz-Hochburg Lübeck statt. Herzstück des Vereins ist die Website. Hier finden Interessierte einen großen Pool an Ausstellungen und Veranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik – nebst dem Alleinstellungsmerkmal ETV: dem Register Europäischer Totentanz-Darstellungen in Film, Literatur, Tanz, Grafik und Musik.
Die Website werde demnächst neugestaltet. „Sie ist einfach schon sehr alt und hat den statischen Lexikon-Charakter“, sagt Schuhmacher. Künftig soll sie interaktiver werden. Schuhmacher selbst arbeite aktuell an einem Newsletter, der die Mitglieder und Interessierte regelmäßig informieren soll. Er sei als Ergänzung des Totentanz-Heftchens gedacht, das vier Mal im Jahr erscheint und in dem über Veranstaltungen, aber auch über Forschungsergebnisse und neue Totentanz-Entdeckungen berichtet wird. Die Darstellung der ETV auf den Social-Media-Kanälen sei bislang an der Manpower gescheitert. Aber auch das wird Henry Schuhmacher sicherlich auf den Weg bringen.
Von Anna Lischper
Sie wollen mit Henry Schuhmacher Kontakt aufnehmen? h.schuhmacher@totentanz-online.de


Porträt: Lioba Abrell
Auf der Suche nach dem inneren Licht
Lioba Abrell leistet als Steinbildhauerin und Trauerrednerin Trauerarbeit
Wenn Lioba Abrell in ihren dunklen Mantel gekleidet auf eine Trauergemeinde trifft, um Worte für einen verstorbenen Menschen zu sprechen, dann ist sie eine Exotin in der katholisch geprägten Gegend um Aitrach. Dort, unweit des Allgäus, werden freie Trauerzeremonien noch selten abgehalten. Abrell, die seit einem Jahr Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal ist, hat sich vor drei Jahren auf das Angebot von freien Trauerreden fokussiert, weil sie eine Antwort geben wollte – neben ihrer Arbeit als Steinbildhauerin und freie Künstlerin ein weiteres Glied in ihrer beruflichen Laufbahn, das sich wie selbstverständlich hinzufügte.
„Nachdem ich aus der Kirche ausgetreten bin, stellte ich mir die Frage, wie ich einmal verabschiedet werden will.“ Wie bei vielen anderen Friedhofsthemen kämen neue Bewegungen erst verzögert im Süden Deutschlands an – freie Trauerredner gibt es dort kaum, ebenso verhalten ist die Nachfrage. Als die Corona-Pandemie alle Türen zugeschlagen hatte, Galerien geschlossen waren und keine neuen Ausstellungen und Projekte geplant wurden, folgte Abrell dem Impuls, sich als Trauerrednerin ausbilden zu lassen, um anderen Menschen, die sich wie sie der Kirche abgewandt haben, eine Alternative zu bieten. „Es war die beste Zeit, um etwas zu verfolgen, was ich schon seit vielen Jahren umkreiste. Zugleich hatte ich die Befürchtung, nie als Trauerrednerin arbeiten zu können, weil ich auf Beerdigungen eigentlich immer die erste bin, die weint.“ Die Ausbildung zur Trauerrednerin knüpfte dort an. Stimm- und Sprechtraining, journalistisches Handwerkszeug zum Schreiben, psychologische Basics und solche zu Marketing und Trauerarbeit verinnerlichte sie und verband es mit ihrer wohl wichtigsten Gabe: zuhören zu können. „Die Situation, dass Angehörige und Freunde Verstorbener kurz nach dem Tod vor mir sitzen, kannte ich aus den Gesprächen zu Grabsteinen. Einen schönen Abschied mitzugestalten, fand ich schon immer etwas ganz Besonderes. Noch schöner, wenn es darum geht, einen Ort zum Trauern zu gestalten.“ Damit sie selbst für die Hinterbliebenen der Fels in der Brandung sein könne, ging es für sie im Seminar auch darum, zu lernen, „was ist meine Trauer und was ist die Trauer der anderen, was ist meine Rolle und wo kann ich den Angehörigen eine Hilfe sein“.
14 Trauerreden hielt sie 2023 – immer häufiger auch für Menschen, die sie schon einmal gehört haben und sie ebenfalls engagieren wollten. „Dass sich meine Arbeit herumspricht, macht mich stolz und bestätigt mich in meiner Arbeit.“
Die Arbeit als Trauerrednerin knüpft an ihre langjährige Erfahrung als Steinbildhauerin an. Anders als bei den Trauerreden, die sie meist für erwachsen verstorbene Menschen hält, entwickelt sie einen Großteil der Grabsteine für und mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben – Sternenkindeltern, aber auch solche von Kindern, die sterbenskrank waren oder durch einen Unfall zu Tode kamen. Dass sie und ihr Mann Gianni Iannuzzi selbst ihren Sohn Gabriel verloren haben, sieht sie als hilfreiche Basis für das Gespräch mit anderen Eltern. „Der Gedanke daran löst in mir einen unglaublichen Schmerz aus. Aber er ermöglicht mir, mit den Eltern mitzugehen, wenn sie die Tür aufmachen und runtergehen.“ Sie und ihr Mann haben dadurch gelernt, wie fragil Leben sein kann. Und sie bezeichnet es als „irres Geschenk“, dass nach Gabriel Antonio und Marlene geboren wurden, die heute 13 und 10 Jahre alt sind.
Für die Gespräche mit den Hinterbliebenen kommt sie gern zu ihnen nach Hause. „Ich komme über den Ort dem Verstorbenen näher und bekomme ein viel besseres Gesamtbild.“ Anders als beim Schreiben und Halten von Trauerreden sei die Entwicklung eines Grabsteins eine gemeinschaftliche Aufgabe. „Hier richtet es sich nach dem Tempo der Angehörigen. Da habe ich auch schon mal gehört: Jetzt machen wir erst einmal eine Pause und im Frühling kommen wir wieder.“ Und wenn sie dann wieder an ihrem Schreibtisch sitzt, laufen ihr auch mal die Tränen. Individuelle Trauer zuzulassen und sich Zeit dafür zu nehmen, ist ihr ein Anliegen – genauso wie die persönliche Beschäftigung mit Tod und Sterben. „Diese Themen faszinieren mich schon immer und sie spielen eine Rolle bei all meinen Tätigkeiten.“
So führte die gebürtige Baden-Württembergerin ihr Interesse an den Naturwissenschaften und an natürlichen Zusammenhängen zunächst an die Universität Ulm, um Medizin zu studieren. „Ich hatte ein Bild im Kopf, wie ein Mediziner so ist. Ich dachte, ich gehe nach Afrika und rette die Welt.“ Das Bild des Mediziners stellte sich in der Realität anders dar: „Der Grundgedanke, dass man als Arzt weiß, was zu tun ist, und der dem Patienten sagt, was er zu tun hat, gefiel mir nicht.“ So war nach vier Semestern Schluss. „Gesundheit ist aus meiner Sicht etwas, an der mehrere Menschen gemeinsam arbeiten. Mir war diese Welt zu kalt und zu dogmatisch. Es gibt immer mehrere Lösungen und Sichtweisen“, sagt Abrell. Im Nachhinein sei es wohl das Interesse am Anstrengenden und Schwierigen gewesen, was sie zum Medizinstudium gebracht hat. Weil es sie anzieht – genauso wie die oft das Unbekannte begleitende Angst. „Wir sind ja nicht hier, um uns zu pampern“, sagt die 49-Jährige. Und diesen Ansatz trägt sie seit vielen Jahren mit sich. „Wer zur Angst geht, der kommt auch zur Lösung.“
1997 begann sie eine Ausbildung zur Steinbildhauerin und schloss der Ausbildung ab 2003 ein Studium an: Sie studierte Freie Kunst an der Kasseler Kunsthochschule bei Dorothee von Windheim und beendete das Studium als Meisterschülerin. In Kassel besuchte sie oft das Museum für Sepulkralkultur, fand darüber auch einen Zugang zur Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. „Zum einen interessierten mich die Ausstellungen, zum anderen verfolgte ich gern Themen wie die Entwicklung des Friedhofs.“ Besonders spannend findet sie die Anknüpfung an die Forschung durch das Zentralinstitut für Sepulkralkultur. „Das ermöglicht, immer aktuell zu sein.“ Auch Lioba Abrell forscht – allerdings weniger wissenschaftlich, als mehr im Sinne des Nachforschens. Denn über die Beschäftigung mit dem Friedhof und ihre künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Trauer, Tod und Bestattungskultur resultierte auch eine erste Anfrage für eine Gestaltungsarbeit auf dem Aitracher Friedhof. „Der ganze Prozess dauerte länger als sich das der Bürgermeister vorgestellt hatte, aber wenn es um Friedhofsgestaltung geht, finde ich es wichtig, dass alle Bedürfnisse gehört werden.“ So fand sie im Team mit anderen Fachleuten neue Beisetzungsangebote für den traditionellen Friedhof: eine individuelle Alternative zu anonymen Bestattungsfeldern etwa und ein Grabfeld für Sternenkinder. „So gesehen begleite ich die Entwicklung des Friedhofs im Kleinen. Auf dem Friedhof ist so vieles möglich – so lange die Veränderung mit Würde passiert und sie den Menschen guttut.“ Aktuell begleitet sie die Entstehung von zwei Sternenkind-Grabstellen in Isny und eines Denkmals für ein anonymes Grabfeld in Heimertingen.
Die Arbeit als freie Künstlerin ist für Lioba Abrell eine wichtige Ergänzung. „Wenn ich grummelig werde, weiß mein Mann, dass er mich ins Atelier schicken soll“, sagt sie schmunzelnd. „Wo kommen wir her?“ und „Wo gehen wir hin?“ sind Fragen, die sie auch als Künstlerin beschäftigen. Das Durchdringen des Unbekannten, das sich der Angst Stellen sind Dinge, die sie anziehen und für die ihr das Materielle eine weitere Möglichkeit der Auseinandersetzung gibt. Stein, Pflanze, Tier, Mensch – Lioba Abrell ist sicher, dass alles, was mit Natur zu tun hat, untereinander verwandt ist. Daher schaut sie nicht nur bei Menschen in das Innere und kehrt es mit Worten nach außen. Sie sucht auch in Material wie Stein nach dem Licht im Inneren und erforscht anhand von Naturmaterialien das Verhältnis von Innenraum und Grenze, Tod und Leben. Wer ihre Skulpturen betrachtet, sieht oftmals nur noch die Schale. Zu ihren auffälligsten künstlerischen Arbeiten gehören ausgehöhlte Steine – auch dies ein Versuch, ins Innere vorzudringen. Einmal habe sie die ausgehöhlten Steine nachträglich mit Luken versehen: „Sie kamen mir einfach zu nackt vor.“ Für Lioba Abrell ist es klar, dass, wer sich öffnet, auch verletzbar ist. Es ist ihre Profession, sorgsam damit umzugehen.
Wollen Sie mit Lioba Abrell ins Gespräch kommen?
Email: info@liobaabrell.de
Im Internet: www.liobaabrell.de; www.trauerrednerin-abrell.de; www.grabmale-abrell.de


Über den Tellerrand auf den Friedhof
Projekte sind das Spezialgebiet der Diplom-Designerin und Prozessbegleiterin Melanie Torney


Über den Tellerrand gucken, beobachten, Räume für Ideen entwickeln – das ist Melanie Torneys Strategie, die sie täglich verfolgt. Die 46-Jährige ist Projektleiterin auf dem Ohlsdorfer Parkfriedhof, studierte Designerin und im Mai 2023 wurde sie in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal gewählt. Ein Porträt.
Seit Juni 2019 verantwortet die Wahlhamburgerin, die in Solingen (Bergisches Land) aufwuchs und lange in Köln lebte, als Projektleiterin den komplexen Transformationsprozess »Ohlsdorf bewegt!« bei der Hamburger Friedhöfe AöR. In diesem Kontext begleitet sie strategisch, operativ und kommunikativ die Umwandlung von Friedhofs- in Parkflächen. Sie entwickelt Beteiligungsformate, setzt Beteiligungsprojekte um und verantwortet die Kommunikation der Aktivitäten mit den angrenzenden Stadtteilen sowie mit den gesellschaftlichen und politischen Akteur*innen. Zu ihren Aufgaben gehört es zudem, den Veränderungsprozess in die Organisation hinein zu steuern. In dieser Rolle ist sie auch Ansprechpartnerin für Akteur*innen, die den Parkfriedhof mit ihren Projektideen beleben wollen. „Ich gestalte hier einen Rahmen, in dem alle, die es betrifft, miteinander in Kontakt und Fokus kommen und Vereinbarungen treffen können.“ Dabei geht es ihr nicht darum, fertige Lösungen überzustülpen, sondern den Nährboden für Ideenentwicklung zu schaffen. Torney sagt, sie begleitet ergebnisoffene Prozesse – eine facilitative Grundhaltung, die es aus ihrer Sicht dafür braucht, bringt sie mit. Wesentlich fürs Gelingen ist es, das ganze System abzubilden und im Vorfeld eines Prozesses zu überlegen, wer alles dabei sein muss, damit es gelingt: „Macht es etwa Sinn, einen Hausmeister einzuladen, weil er ein spezifisches Fachwissen hat? Oder Stellvertretende bestimmter Nutzergruppen?“
Startschuss der Nutzung der „ausgemusterten“ Kapelle DREI war während der Pandemie die benachbarte Grundschule, die die großzügigen Räume für ihren Theaterunterricht genutzt hat, als große Räume aufgrund der Abstandsregeln rar waren. Es folgte eine Ausstellung eines Künstler*innen-Kollektivs um Xiyu Tomorrow aus Hamburg-Wilhelmsburg zum Thema Trauern in Zeiten von Corona. Ein weiteres Highlight war die Trauer-Druck-Werkstatt der Hamburger Designerin Petra Saborny, bei der Jung und Alt eingeladen waren, ihre Trauer künstlerisch auszudrücken und mittels des Riso-Druckverfahrens, direkt auf hochwertigem Papier umsetzen zu können. Zudem finden bis heute regelmäßig Yoga-Kurse in der ältesten Kapelle des Ohlsdorfer Friedhofs statt. Über ihren ganz besonderen Arbeitsort sagt sie: „Ich liebe es, von der belebten Hauptstraße am Verwaltungsgebäude ins Vogelgezwitscher und Grün abzutauschen. Dann bin ich in einer anderen Welt, in der ich zur neugierigen Erkunderin werde: Was ist das für ein Stein? Wie wurde dieses Grab gestaltet?“ Das Besondere an Ohlsdorf sei, dass er zunächst wie ein großer, schöner Park wirke. „Und dann kommt plötzlich ein Trauerzug vorbei.“
Während zu Beginn ihrer Tätigkeit, der übrigens auch schon die freiberufliche Betreuung verschiedener Kommunikationsdesignprojekte für OHLSDORF – DER PARK voranging, pandemiebedingt die meiste Arbeit aus dem Homeoffice passierte, hat Torney mittlerweile ein Parkbüro in der Kapelle DREI. Der Vorteil: Hier können auch zufällige Kontakte entstehen. „Unsere Räume hier stehen grundsätzlich erst einmal allen offen und alle Anfragen werden geprüft.“ Fußballturnier auf dem Friedhof? Eher nicht. Bei Qi-Gong sieht das schon wieder anders aus. Bei der Prüfung stellt sich Torney auch immer die Frage, wo auf dem Friedhof ein guter Ort für eine Veranstaltung ist und bringt die Terminplanung in Einklang mit anstehenden Bestattungen. Seit Sommer 2022 verstärkt ein weiterer Mitarbeiter das Team: Fred Finzel „gute Seele der Kapelle“, betreut die Nutzer*innen – ein Zeichen für den Zuspruch, den Ohlsdorf als Ort für Kultur und Austausch bekommt.
Ihre fachliche Expertise im Kontext Workshop-Moderation sowie die professionelle Begleitung von Großgruppen und Prozessen bekam sie unter anderem durch die Ausbildung als Facilitatorin an der Facilitation Academy Berlin. Dass Melanie Torney einmal die Transformation des größten Parkfriedhofs der Welt begleiten wird, war nicht abzusehen, deutete sich allerdings auf unterschiedlichen Ebenen an. Nach ihrem Fachabi hatte sie 2002 bis 2007 den interdisziplinär ausgerichteten Studiengang Design an der Köln International School of Design (FH) studiert. Das an dem interdisziplinären Konzept des Bauhaus ausgerichtete Studium beinhaltete neben Produkt- und Kommunikationsdesign u.a. auch ökologische und philosophische Lehrgebiete. „Das ‚out of the box-Denken‘ des Studiums beeinflusst noch heute meinen Arbeitsprozess.“ Ihre Examensarbeit war ein Buch über den Tod. „Ich hatte im Freundeskreis viele Erfahrungen gemacht mit Krankheit, Tod und Trauer. Der Vater einer Freundin verstarb und ich sah die Hilflosigkeit der Menschen in dieser Situation. Und das brachte mich zu der Frage: was kann ich als Designerin tun, um in so einer Situation zu empowern?“ Wie läuft eine Bestattung ab? Was ist ein Hospiz? Muss ich mich auf der Beerdigung Schwarz kleiden? Ihre Recherche brachte sie auch in das Museum für Sepulkralkultur. So entstand ein Buch, in dem man durch verschiedene Themenwelten flanieren kann. „Es ist eigentlich vielmehr eine Ausstellung gewesen, als ein Buch.“ Seitdem sind die Themen Sterben, Tod und Trauer Herzblutthemen.
Schon während der Recherchephase zu ihrer Examensarbeit hatte sie als „Kommunikationsdesignerin mit Papierleidenschaft“ mit ihrem Partner die Edition ANFANG ENDE gegründet: für zeitgemäße, alternative Papeterieprodukte von der Trauerkarte bis zur Kondolenzmappe. Alternativ im Sinne, dass Trauernde aus ihrer Sicht Freiraum zur individuellen Gestaltung brauchen, um die Trauer auf eine für sie stimmige Art und Weise auszudrücken. Vor einem halben Jahr hat sie die noch übrige Lagerware der Trauerkartenkollektion aus Gründen fehlender Zeit an einen Benefiz-Laden übergeben. Jetzt konzentriert sich das Angebot der Edition ANFANG ENDE auf Kondolenzkarten, individuelle Anfertigungen für die Trauerkommunikation und Workshops für Unternehmen.
Außerdem gründete Melanie Torney das Netzwerk Trauerkultur mit. „Ich hatte den Eindruck, dass man mit Veranstaltungen Raum für echten Dialog geben kann.“ So entstanden u.a. Kooperationen, mit alternativen Bestatter*innen sowie Hamburger Museen, Institutionen und Gastronom*innen. Ziel der Veranstaltungen war es, auch kontroverse Themen anzubieten. Bis Ende 2018 betreute sie auch das Death Café in Hamburg – ein weltweit angebotenes, unkommerzielles Veranstaltungsformat, das von jungen bis hochbetagten Menschen besucht wurde. Hier kamen Interessierte, Betroffene und Expert*innen ungezwungen und – je nach Belieben – vertrauensvoll oder oberflächlich miteinander in den Austausch rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer. „Es ist mittendrin im Leben und niedrigschwellig, offen für alle, die sich ungezwungen mit dem Thema auseinandersetzen wollen.“
Es ist wohl auch die Lust, gemeinsam etwas Gutes zu schaffen, sei es einen Rahmen für Austausch über die Endlichkeit oder eine Plattform, auf der individuell getrauert werden kann, die Melanie Torney vor einigen Jahren dazu gebracht hat in das Netzwerk Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal einzusteigen. „Ich mag das Museum und den Austausch auf der Friedhofsverwalter*innen-Tagung.“ Aus ihrer Mitgliedschaft sind zahlreiche Kontakte entstanden. Im Mai 2023 wurde Torney als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Und was macht die Diplom-Designerin und Prozessbegleiterin in ihrer Freizeit? Radfahren mit der FLINTA-Rennradgruppe des FC St. Pauli – stadtauswärts am Hamburger Deich entlang durch die Vier- und Marschlande. Und ins Kino gehen, lesen: „am liebsten Dramen und Tragödien“.
Von Anna Lischper
Erinnerung in Fotografie und Stein
Steinmetz und Fotograf Johannes Twielemeier seit 25 Jahren Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Ein gefliester Raum mit Waschbecken, die Ansicht eines leeren Flures mit vielen Türen, Bilder einer besonderen Architektur. Johannes Twielemeier wird von Un-Orten angezogen. „Von Orten, zu denen andere Fotografen gar nicht erst hinfahren“, sagt er. „Mich interessiert eher der Stadtrand als das Zentrum, und Orte, denen man ansieht, dass Zeit vergangen ist.“ Vergänglichkeit, Verlassenheit, Vergessenheit – das sind Themen, die den 1960 in Westenholz geborenen Fotografen seit jeher interessieren. Und im weitesten Sinne auch der Tod.
Im November erscheint ein Bildband mit Fotografien des Aachener RWTH-Krankenhauses. Auslöser war eine Fotoausstellung zum Jubiläum, für die Fotografen das Haus mit anderen Augen sehen sollten. „Meine Bilder deuten nicht auf ein Krankenhaus hin. Ich thematisiere das Gebäude und dessen Architektur und habe mich dafür komplett freigemacht davon, dass ich ein Krankenhaus fotografiere." Hört man Twielemeier zu, wie leidenschaftlich er von seinen bisherigen Fotoprojekten erzählt, glaubt man kaum, dass er die Fotografie seit einigen Jahren im Standby-Modus betreibt. Sein Hauptberuf ist Steinmetz & Bildhauermeister.
Als es damals nach der Schulzeit darum ging, einen Beruf zu lernen, fasste er zunächst den Plan, Fotograf zu werden. Doch die Zeiten in der Dunkelkammer schreckten ihn bei einem Praktikum ab. So schlug er das Branchenbuch auf, um nach Ausbildungsbetrieben für das Holzbildhauer-Handwerk zu schauen. „Holz und Stein lagen direkt nebeneinander. Also rief ich einfach mal bei einem Steinmetzbetrieb an.“ In der Ausbildung sei er viel zu freidenkend unterwegs gewesen. „Für den Meister war ich eine Nervensäge.“ Er zog die dreijährige Ausbildung durch und entwarf 1986 erstmals einen Grabstein. Sein Onkel Anton starb und die Familie ließ ihm freie Hand in der Gestaltung. Das Ergebnis war ein Stein, „der in Grundzügen schon so war, wie ich heute arbeite. Mit einer langen Phase des Entwerfens und Unmengen an Skizzen“. Heute steht der Stein auf dem Bauernhof seines Bruders in Westenholz.„Immer wenn ich meinen Bruder besuche, sehe ich auch den Stein, der mein Erweckungserlebnis war“, weiß Twielemeier heute. „Ich sagte ja zum Bildhauerhandwerk, aber auch ja zum Künstler.“ Woher sein Hang zum Grabmal kommt, kann er sich nicht erklären. „Aber das Thema Tod interessiert mich schon immer, in der Kunst, in der Literatur, im Film und in der Musik.“
Nach der Ausbildung war für ihn klar, dass er ein Studium bräuchte, um sich weiterzuentwickeln. Aus finanziellen Gründen arbeitete er allerdings zunächst mehrere Jahre in verschiedenen Werkstätten in Hamburg, Paderborn und Freiburg. Auch dort wurden seine Ideen meist als Flausen bezeichnet. Ein Zuhause für seine Ideen fand er schließlich nach der Meisterprüfung an der Akademie für Handwerksdesign Gut Rosenberg in Aachen, wo er seinen Abschluss als Meisterdesigner machte. „Das Studium hat mir so viele Fragen beantwortet und meine künstlerische Perspektive wurde dadurch eine völlig andere.“ Dem Grabstein blieb er treu und erntete dafür Sätze wie „Du immer mit deinen Grabsteinen. Du kannst ja ganz andere Sachen machen.“ Seine Examensarbeit: Eine Urne aus Stein. „Diese Urne hat so viel in Frage gestellt – durchgesetzt hat sich die Idee aber nicht.“ Seine Examensarbeit sei es schließlich gewesen, die ihn auch mit dem Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur in Kontakt brachte. Viele Stunden verbrachte er in der hauseigenen Bibliothek, und „kopierte fleißig“. Er lernte den damaligen Direktor Rainer Sörries kennen – ein Kontakt, der bleiben sollte.
Nach dem Studium arbeitete er zehn Jahre lang als Steinmetz und Bildhauermeister in Aachen, begann parallel, sich als Dozent an der Akademie für Handwerksdesign in den Fächern plastisches Gestalten und Fotografie um den Nachwuchs zu kümmern, der er selbst einmal war. Er merkte, dass ihm diese Arbeit wichtiger ist, als das Angestelltendasein und machte sich letztlich 2009 mit einer eigenen Werkstatt selbständig.
„Ich soll erzählen? Wieso? Ich möchte doch nur einen Grabstein aussuchen.“
Vor wenigen Tagen kam ein Kunde zu Johannes Twielemeier ins Büro und fragte nach Beratung. In seiner etwas entlegenen Werkstatt ist Laufkundschaft eher selten. „Er erzählte erst einmal eine halbe Stunde davon, was er schon alles erlebt hatte. Dass ihm bislang keiner der Kollegen zuhörte, er sich unverstanden fühle. Ich machte mir während des Gesprächs Skizzen auf der Skizzenrolle und ließ ihn erzählen. Nach einiger Zeit sagte er: ja, genauso habe ich mir das vorgestellt.“ Zuhören, zwischen den Zeilen lesen, sensibel und empathisch – das ist Twielemeier wichtig. So vergehen vom ersten Gespräch mit den Hinterbliebenen bis zum fertigen Stein schon mal vier bis fünf Monate. In seinem Büro werde viel geweint, aber auch viel gelacht. Er lockt Erinnerungen heraus, lässt sich Bilder zeigen. „Der Körper, aber auch der Beruf, alles fließt in das Grabmal ein, damit es etwas vom Wesen des Verstorbenen wiederspiegelt.“ Er stellt den Menschen in den Fokus und wird auch schon im ersten Gespräch mit Angehörigen persönlich. „Das lässt nicht jeder zu. Ich habe auch schon gehört: Meine Oma war zwei Mal geschieden, aber was spielt das jetzt für eine Rolle?“
40 bis 50 Steine fertigt Twielemeier mittlerweile im Jahr für Menschen in ganz Deutschland. Seine Dozentenstelle an der Aachener Akademie hat er in diesem Jahr beendet. Mit ihm verabschiedet sich ein Dozent, dem es stets wichtig war, auf Augenhöhe mit den Studierenden zu sprechen, sie in ihrem freien Denken zu unterstützen und ihnen das weiterzugeben, was er selbst als junger Mensch oftmals vermisste.
Der Erfolg, den ihm sein eigener Hang zum Freidenken gebracht hat, beweisen die vielen Auszeichnungen, die er mittlerweile für seine Arbeiten erhalten hat. Zuletzt bekam er beim Gestaltungswettbewerb Grabzeichen des Landesinnungsverbands Baden-Württemberg erneut die Gold / Silber und Bronzemedaillen für seine eingereichten Grabzeichen.
Der Stein und die Fotografie. Während sich der Steinmetz Johannes Twielemeier als Dienstleister versteht, sucht der Fotograf die künstlerische Freiheit. Wenn er auch nicht mehr so häufig mit der Kamera unterwegs ist, wie noch vor einigen Jahren – die Fotografie bleibt ein Teil seines Ausdrucks. Auch hier hat er sich entwickelt. „Der Reiz am Fotografieren hat mit Festhalten zu tun. Aber mein hardcore-dokumentarischer Ansatz hat sich verändert. Objektive Dokumentarfotografie gibt es nicht.“ 2010 hatte die Ausstellung „Orte ohne Wiederkehr“ im Museum für Sepulkralkultur seine Fotografien gezeigt, die im Zuge der Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler entstanden waren. Zwischen 2000 und 2009 war er einmal im Monat in die vom Abriss bedrohten Dörfer gefahren und fotografierte. „Alles musste weg. Die Menschen, die Betriebe, selbst die Friedhöfe zogen um. Tote wurden exhumiert und mit Umbettungssärgen auf neue Friedhöfe verfrachtet.“ Was blieb, waren verlassene Häuser, leere Straßen, umgegrabene Friedhöfe - eine Landschaft in Agonie.
Neben seiner künstlerisch fotografischen Verbundenheit zum Museum für Sepulkralkultur befinden sich dort auch Steinarbeiten: Zwei Arbeiten von ihm wurden in die Sammlung aufgenommen. „Zeigen und Bewahren“, eine Urne aus Stein mit bootsförmigem Unterteil aus Baumberger Sandstein sowie die Arbeit „Die Totenstadt“ aus Anröchter Dolomit, die 2010 für die „Orte ohne Wiederkehr“ Ausstellung entstanden ist. Für die Treue zur Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. bekam er dieses Jahr auch das Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft, das Bildhauer und Steinmetzmeister Hermann Freymadl aus Gernsheim gestaltet hat. Twielemeier räumt ein, er sei ein eher passives Mitglied, aber suche doch immer mal wieder den Kontakt, regelmäßig etwa zum stellvertretenden Direktor Gerold Eppler, der ja auch ein Steinmetz-Kollege ist.
Mit dem Tod beschäftigen, ja, aber dann auch richtig leben. Mit seinem Royal Enfield Motorrad etwa, das er sich jüngst gekauft hat, durch die Eifel fahren. In den entlegenen Dörfern und ursprünglichen Landschaften entsteht seit etwa einem Jahr ein neues Fotoprojekt. Motorrad hin oder her – seine Indie-Rockband-Zeit hat er lange hinter sich gelassen: das Schlagzeug ist seit Jahren eingemottet. Vor Kurzem hat er sich das neue Lana del Rey-Album gekauft. Im ersten Moment passt das doch irgendwie auch besser zu dem Mann, der Steinen menschliches vermacht und verlassenen Orten mit Fotografien ein Denkmal setzt.
Anna Lischper
Wollen Sie mit Johannes Twielemeier ins Gespräch kommen?
Hier ist sein Kontakt: Mobil: 0176 82199506; E-Mail: johannes.twielemeier@gmx.de
www.johannestwielemeier.de


Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
Zentralinstitut für Sepulkralkultur
Museum für Sepulkralkultur
Weinbergstraße 25–27
D-34117 Kassel | Germany
Tel. +49 (0)561 918 93-0
info@sepulkralmuseum.de